Service
Auf dieser Seite finden Sie sämtliche Hilfsmittel und Serviceangebote der Kanzlei Michaelis
Service-Übersicht:
+++ Cyber-Versicherungsschutz +++ Experten-Suche +++ telefonische Beratungsflatrate +++ Berechnung des Ausgleichsanspruch eines Handelsvertreters +++ Service bei Beantragung von BU-Leistungen +++ Ombudsmannverfahren +++ Expertenbeirat für Vermittler und Makler +++ Vollmachten +++ kostenlose Patientenverfügung +++ gesetzliche Grundlagen +++ Bestandskäufer gesucht +++ Werbung für Rechtsberatung +++
Weitere Hilfsmittel und Serviceangebote der Kanzlei Michaelis
Cyber Versicherungsschutz nur für Versicherungsmakler
Als Berater für Versicherungsmakler halten wir auch den Versicherungsschutz einer Cyber-Deckung für Versicherungsmakler für sehr wichtig. Wir haben deshalb daran mitgewirkt, das bestmögliche Produkt für unsere Mandanten zu entwickeln. Wir glauben, dies ist uns mit dem Versicherer Markel gelungen. Nicht nur ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch eine hervorragende Erweiterung des Versicherungsschutzes für Versicherungsmakler konnte mit den besonderen Bedingungen verhandelt werden. Überprüfen Sie es bitte selbst! Sie sind Experte!
Dieser Versicherungsschutz für Versicherungsmakler ist aus meiner Sicht derzeit der Beste am Versicherungsmarkt und in jedem Fall einmalig! So soll es auch in Zukunft bleiben. Wir bleiben in einem engen Kontakt, um für unsere Makler den bestmöglichen Versicherungsschutz begleiten zu können. Dabei versteht es sich von selbst, dass wir entsprechend der Versicherungsbedingungen unsere Mandanten im Leistungsfall kostenfrei gegenüber dem Versicherer vertreten. Aber Achtung, wir vermitteln nicht selbst diesen Versicherungsschutz. Wir sind nur für den Makler und den VN unterstützend rechtsberatend tätig.
Den einzigartigen Versicherungsschutz mit der Kanzlei Michaelis Klausel für Makler finden Sie hier.
Warum wir den Versicherungsschutz für besonders wichtig erachten, finden Sie auch in der Begründung dieses lesenswerten Artikels:
Ist der Geschäftsführer für die IT-Sicherheit und daraus drohende Schäden haftungsverantwortlich?
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Beratung oder auch eine Dokumentation der Beratung bei diesem Produkt nicht vorgesehen ist. Die Cyberversicherung von Markel (Cyber Pro) mit den besonderen Bedingungen, die die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte mit verhandelt hat, ist ein Produkt, welches sich ausschließlich an Versicherungsmakler mit der eigenen Berufszulassung nach Paragraf 34d Gewerbeordnung richtet und nur für den Eigenbedarf abgeschlossen werden kann.
Wir gehen davon aus, dass Sie als zugelassener Versicherungsmakler daher die erforderliche Sachkunde haben, dieses Produkt zu verstehen.
Daher haben wir uns entschlossen, eine Beratung oder auch eine Dokumentation der Beratung bei der Vermittlung in der Regel nicht vorzunehmen.
Aufgrund der Versicherungsbedingungen unterstützt die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte Sie aber im Leistungsfall, wenn der Versicherer nicht die von Ihnen gewünschte Versicherungsleistung erbringt.
Wir möchten Sie daher bitten, dass Sie mit den Markel-Antragsunterlagen auch die beiliegende Verzichtserklärung unterzeichnet einreichen. Anderenfalls kann nur in extremen Ausnahmefällen eine individuelle Beratung des Versicherungsmaklers erfolgen.
Die Verzichtserklärung finden Sie hier.
Video zum Thema Cyberversicherung
In diesem Video zum Thema Cyberversicherung erhalten Sie einen kurzweiligen Überblick des möglichen Versicherungsschutzes. Rechtlich befasst sich Herr Rechtsanwalt Lars Krohn mit den aufgeworfenen Fragestellungen. Gleichzeitig ist der Praktiker und Versicherungsmakler Herr Götz Lebuhn mit seinen Erläuterungen eingebunden. Die Moderation und Fragestellung erfolgte durch Rechtsanwalt Stephan Michaelis.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem hinterlegten Video. Am Ende der Aufzeichnung gehen wir auch noch mal auf die besonderen Versicherungsbedingungen von Markel ein. Es handelt sich dabei um das spezielle Cyber-Versicherungskonzept nur für Versicherungsmakler von der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte.
Sonderausgabe von Experten-Report
Maklerstammtisch vom 12.02.2020: Cyberdeckungen mal rechtlich
Experte gesucht?
Sie sind auf der Suche nach einer hervorragenden Versicherung, wollen diese aber nicht einfach so im Internet abschließen?
Dann sind Sie hier genau richtig!
Wir finden für Ihre Versicherungswünsche garantiert einen sehr qualifizierten Versicherungsmakler als Berater! Die Empfehlung und die anschließende Beratung sind KOSTENFREI!
Aufnahmeantrag VUN - und experten-Report Verband für Unternehmensnachfolge e.V.
Download Aufnahmeantrag VUN – Verband für Unternehmensnachfolge e.V.
Jetzt lesen: expertenReport 02/21
Telefonische Beratungsflatrate
Nutzen Sie unsere telefonische Beratungsflatrate.
Infos und den rechtsverbindlichen Beratungsauftrag finden Sie hier.
Berechnung des Ausgleichanspruchs des Handelsvertreters
Lassen Sie sich für € 99,- (netto) den Ausgleichsanspruch eines Handelsvertreters nach den „Grundsätzen“ von Fachanwälten für Handelsrecht ausrechnen.
Beratung zur BU-Leistungsbeantragung
Service bei Beantragung von BU-Leistungen
Gerade in der Berufsunfähigkeitsversicherung ist die Beantragung von Leistungen besonders schwierig und häufig schon qualifizierte Rechtsberatung erforderlich. Eine Vielzahl von Informationen und Unterlagen sind zu prüfen, zu sortieren und geordnet beim Versicherer einzureichen. Der Versicherungsnehmer gerät hier schnell an seine Grenzen. Bereits in diesem frühen Stadium des Leistungsfalles beginnt die Weichenstellung für die gewünschte reibungslose und möglichst schnelle Abwicklung beim Versicherer. In den vergangenen Jahren konnten viele Versicherungsnehmer BU-Leistungsanträge unter Mithilfe von Rechtsanwältin Kathrin Pagel mit schnellem Erfolg einreichen.
Sie benötigen Hilfe bei der Beantragung von Berufsunfähigkeitsleistungen? Rechtsanwältin Kathrin Pagel, unserer Spezialistin für die Berufsunfähigkeitsversicherung, berät Sie gern.
Ombudsmannverfahren

Wir begleiten unsere Mandanten auch bei PKV Ombudsmannverfahren (für die private Krankenversicherung) im Versicherungswesen. Hierfür brauchen wir neben allen Sachverhalts-Informationen auch bitte die beiden Unterlagen ausgefüllt zurück:
1) Vollmacht
Wir danken für Ihre Unterstützung.
Expertenbeirat für Vermittler und Makler
„Unser“ oder besser Ihr Beirat, den wir Ihrer Unternehmung anbieten können, bestehend aus Herrn Professor Dr. Zeidler, Herrn Dipl.Ing. Müller-Delius und Herrn Rechtsanwalt Stephan Michaelis LL.M. bietet Ihnen höchste Kompetenz aus Wirtschaft, IT und Recht.
Wir unterstützen Sie in der Prozessoptimierung der täglichen Arbeit bis hin zur geplant oder ungeplant Unternehmensnachfolge. Weitere Informationen können Sie der nachfolgenden Broschüre entnehmen. Sprechen Sie uns bei Bedarf gerne an!


Download
 In dem nachfolgenden Download-Bereich finden Sie die Fotos der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte. Wir sind damit einverstanden, dass Sie diese Bilder in einem sachlichen Zusammenhang mit der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte verwenden dürfen.
In dem nachfolgenden Download-Bereich finden Sie die Fotos der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte. Wir sind damit einverstanden, dass Sie diese Bilder in einem sachlichen Zusammenhang mit der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte verwenden dürfen.
Ebenso finden Sie auch einen Download-Bereich hinsichtlich unserer weiteren Bilder, die sich auf unserer Internetseite befinden. Im Falle öffentlicher Publikationen bitten wir höflichst darum, dass vor einer weiteren Verwendung unsere ausdrückliche Einwilligung eingeholt wird.
Download Bildmaterial Beraterteam
Download Bildmaterial Kanzlei Michaelis
Kanzlei Michaelis-Siegel
Aufnahmeantrag VUN – Verband für Unternehmensnachfolge e.V.
procontra – 2018
Infos zu Klara
Bildmaterial für Klara
Erfassungsbogen zur Erstellung einer Versorgungsordnung / Betriebsvereinbarung über betriebliche Krankenversicherung
Erfassungsbogen zur Erstellung einer Versorgungsordnung bAV
Download Patientenverfügung
Nachtrag Handelsvertretervertrag IDD
Datenschutz-Mandat
IHK Mandat
Bestandskäufer gesucht
Bestandskaufvertrag – Lassen Sie sich von unseren Rechtsanwälten der Kanzlei beraten. Erfassungsbogen Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters – Umsatzmitteilungen zum Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters § 89b HGB
Telefonische Beratungsflatrate
Präsentation Betriebsrentenstärkungsgesetz
Einwilligungserklärung Datenschutz
Ausgleichsanspruch
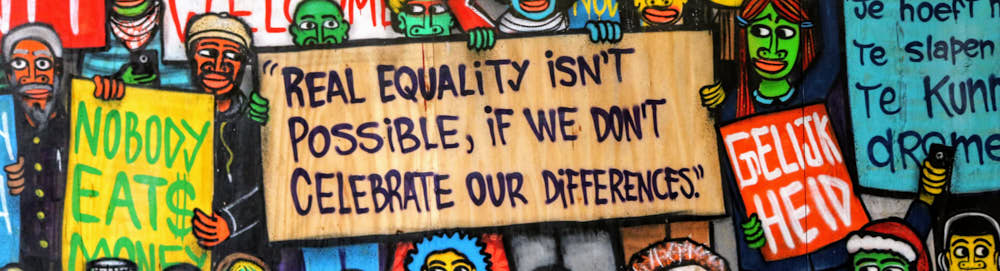
Berechnung des Ausgleichanspruchs des Handelsvertreters
Lassen Sie sich für € 99,- (netto) den Ausgleichsanspruch eines Handelsvertreters nach den „Grundsätzen“ von Fachanwälten für Handelsrecht ausrechen.
Bitte reichen Sie den vollständig ausgefüllten Erfassungsbogen-Ausgleichsanspruch bei der Kanzlei Michaelis ein. Diese wird Ihnen zeitnah das Berechnungsergebnis mitteilen.
Bei Interesse senden Sie uns einfach eine Mail an info@kanzlei-michaelis.de
Vollmachten

Kundenvollmacht auf Empfehlung des Maklers (mit Schweigepflichtentbindung)
Hier klicken: Kundenvollmacht auf Empfehlung des Maklers (mit Schweigepflichtentbindung)
Vertretungsvollmacht
01.01.2010 Zur außergerichtlichen Vertretung als auch Prozessvollmacht in allen Instanzen
Hier klicken: Vollmacht Kanzlei Michaelis
Unsere Datenschutzhinweise
Kostenlose Patientenverfügung

Wenn Sie Interesse an der Patientenverfügung haben, dann übersenden Sie uns bitte Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Sie bekommen dann automatisch eine Mail mit dem Link zur Patientenverfügung zugesendet.
Die EIOPA Recommendation vom 19.2.2019 (in englischer Sprache)
Wichtige Informationen, Unterlagen und Gesetze
Bestandskäufer gesucht
Sehr geehrter Interessent,
sollte sich ein geeignetes Angebot für Sie ergeben, so wären Sie wohl bereit, ein Versicherungsmaklerunternehmen zu erwerben.
Natürlich bedarf es zuvor einer sehr dedizierten Auseinandersetzung mit der potenziellen Firma, wenn es darum geht, eine wirtschaftliche und rechtliche Unternehmensanalyse vorzunehmen.
Damit wir Ihnen aber den unverbindlichen Kontakt zu einem möglichen Verkäufer herstellen können, möchten wir zunächst mittels der nachfolgenden fünf einfachen Fragen eine grobe Kategorisierung Ihrer Wünsche vornehmen. Bitte beantworten Sie uns doch kurz die nachstehenden Fragen.
Profino
Die Kanzlei Michaelis ist auf der virtuellen Vermittler-Messe Profino vertreten.
Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die einzige Rechtsanwaltskanzlei sind, die auf der virtuellen Vermittler-Messe, der Profino, zu finden ist.
Die Profino ist ein einzigartiger großer Online-Marktplatz und Treffpunkt für Versicherungsmakler und andere ungebundene Versicherungsvermittler. Die Profino zählt mittlerweile über 10.000 Fachbesucher. Auch die überwiegende Zahl der namhaften Versicherer ist selbstverständlich auf der Profino zu finden. Hervorzuheben ist, dass die Profino bereits unmittelbar nach ihrem Start den German Innovation Award 2018 gewinnen konnte. Wir gratulieren den Veranstaltern der Profino zu dieser besonderen Auszeichnung von ganzem Herzen!
Sämtliche Anbieter versuchen mit ihrem individuellen Service und Dienstleistungen zu überzeugen. So selbstverständlich auch die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte. Wir sind exklusiver Partner der Profino und informieren und unterstützen die Versicherungsbranche umfassend und aktuell mit und an unserem digitalen Messestand.
Auf unserem Messestand finden Sie insbesondere eine Vielzahl von Online-Fachvorträgen für den Versicherungsmakler. Vom Arbeitsrecht bis zum Versicherungsrecht finden Sie viele interessante Fachbeiträge, die Sie sich jederzeit in Ruhe ansehen oder anhören können. Als Referenten sind natürlich auch Herr Professor Dr. Schwintowski und Herr Rechtsanwalt Michaelis zu hören und zu sehen. Diese Videos der exklusiven Fachvorträge aller Kollegen der Kanzlei Michaelis stehen Ihnen nur über die Profino zur Verfügung.
Achtung: Alle Online-Fachvorträge der Profino finden Sie nicht zusätzlich auf den Seiten der Kanzlei Michaelis!
Zusätzlich finden Sie dort natürlich auch noch eine Fülle weiterer Informationen, die sie ebenfalls auch auf unseren Internetseiten finden können.
Kommen Sie einfach einmal auf der Profino vorbei. Die Onlinemesse ist für alle Fachbesucher kostenfrei. Informieren Sie sich auch dort an dem Stand der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte zu unserem umfassenden Leistungsangebot und sehen Sie sich die dort vorhandenen exklusiven Vorträge an!
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (PIB)
Stephan Michaelis LL.M.
Versicherungsrecht und Versicherungsmaklerrecht
Dr. Jan Freitag
Arbeitsrecht
Kathrin Pagel
Versicherungsrecht
Oliver Timmermann
Vertriebs-und Versicherungsrecht
Markus Kirner
Rentenberater, Spezialist für die betriebliche Altersversorgung
Fabian Kosch
Versicherungs-, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht
Svenja-Martina Burmeister
Versicherungs- und Versicherungsvertriebsrecht
Sarah Kolß
Arbeitsrecht, Handelsvertreterrecht
Judith Pötter
Versicherungs- und Versicherungsvertriebsrecht
Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski
Rechtsanwalt
Arbeitsrecht
Bankrecht
Berufsunfähigkeitsversicherung
Betriebsschließungsversicherung
Datenschutzrecht
Dienstunfähigkeitsversicherung
Gesellschafts- und Vertragsrecht
Gewerblicher Rechtsschutz
GmbH-Recht
Haftpflichtversicherung
Handelsvertreterrecht
Kreditvertragsrecht
Lebensversicherung
Maklerrecht
Markenrecht
Personengesellschaftsrecht
Umstrukturierungen
Unfallversicherung
Versicherungsrecht
Wettbewerbsrecht
Kanzlei
Über uns
Karriere
Honorare
Kontakt | Anfahrt
Impressum
Datenschutz
AGB
Disclaimer
Service
Ausgleichsanspruch
Download
Kanzlei-Kooperationen
Lexikon
Vollmachten
Social Media
Apps
Kontakt
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte
Stephan Michaelis V.i.S.d.P.
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
info@kanzlei-michaelis.de
Tel. +49 40 88888-777
Fax +49 40 88888-737
Partnerschaftsregister
Hamburg PR 251
Ust.-IdNr.: DE204135896
Berufsrechtliche Regelung
Bundesrechtsanwaltsordnung
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
Berufsordnung für Rechtsanwälte
© KANZLEI MICHAELIS RECHTSANWÄLTE
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT






